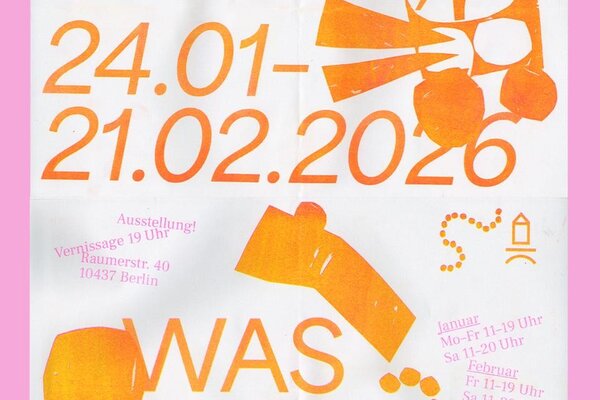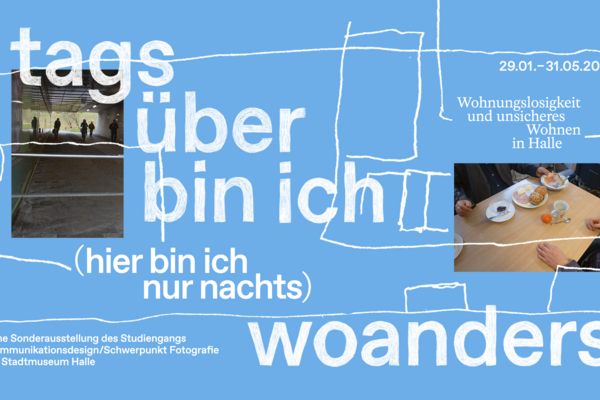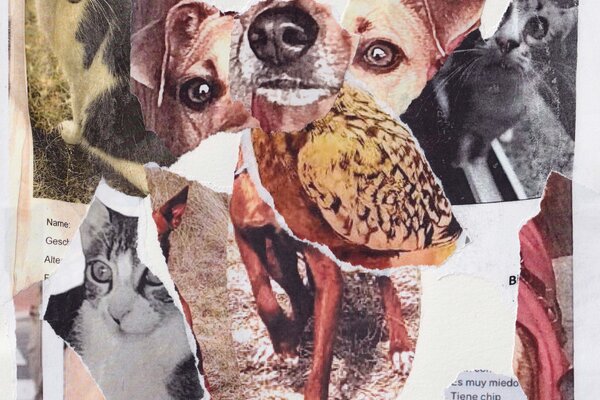Am 21. Januar 2025, hielt Burg-Professorin für Kunstphilosophie und Kulturtheorie, Prof. Dr. Marita Tatari, ihre Antrittsvorlesung im Rahmen des Four Fixe:

Am 21. Januar 2025, hielt Burg-Professorin für Kunstphilosophie und Kulturtheorie, Prof. Dr. Marita Tatari, ihre Antrittsvorlesung im Rahmen des Four Fixe:
Guten Abend und herzlich willkommen.
Mein Vortrag ist als „Vorstellungsvortrag“ angekündigt. Ich möchte hier allerdings weniger meine Forschung präsentieren, sondern mehr die Weise vorstellen, wie ich die Philosophie – in meinem Fall Kunstphilosophie und Kulturtheorie – in der Kunsthochschule verstehe.
Ähnlich wie die Kunst, sehe ich die Philosophie als eine auf die Gegenwart antwortende Praxis. Eine reflexive Praxis, die sich in der Welt für die Welt verantwortet.
Ich möchte im Folgenden einige Kerngedanken mit Ihnen teilen, worum es mir bei dieser antwortenden Praxis geht, und welche Haltung sich daraus bezüglich der Gegenwart, aber auch gegenüber dem Geschichtsverständnis ergibt.
Das Gemeinsame
Das „Schöne“, das „Wahre“, das „Gute“ bezeichneten in der westlichen philosophischen Tradition das Gemeinsame: das, was allen gemeinsam ist, allen Menschen und allem, was ist, als einem an und für sich Wertvollen.
Das Schöne bezeichnete das Gemeinsame in dem Gebiet des Sinnlichen, das Wahre in dem des Begriffs, das Gute in dem Bereich der Handlung.
Sofern das Gemeinsame aber als etwas Gegebenes gilt, als etwas Starres oder Geronnenes, ist es kein Gemeinsames – kein allen Gemeinsames, sondern bildet den Bodensatz einer Gemeinschaft, die sich auslebt, während sie Fremde ausschließt. Totalitär ist in dieser Hinsicht eine Gemeinschaft, die auf etwas Gegebenem gründet, auf einem Ursprungmythos oder einem Ideologem, historisch etwa als Blut und Boden oder im Rassegedanken ablesbar.
Dagegen steht der Begriff der „Demokratie“. Anders als im antiken Athen, wo die Demokratie nur für die freien Männer galt, fördert und verspricht die moderne Demokratie ihrem Begriff nach, die Freiheit jedes Menschen in der Gleichheit aller Menschen. „Demos“ heißt auf griechisch Volk. Das Volk ist aber kein Prinzip. Dementsprechend muss sich die Demokratie der Abwesenheit einer Grundlage aussetzen. Sie muss also (ihrem Selbstverständnis nach) unbegründet bleiben, sonst würde sie den vorgebrachten Grund in Beherrschung und Unterdrückung verdrehen. Deswegen kann das Recht, auf das die demokratische Institution verweist, „in Wahrheit nur in einem stets aktiven und erneuerten Verhältnis zu ihrem eigenen Mangel an Gründung leben“.[1]
Die Demokratie zeichnet sich demnach durch die Herausforderung aus, die Öffnung im Herzen des Gemeinsamen offen zu halten: offen für Andersartige, für Differenz, offen zu Neuverhandlungen, Revisionen, Transformationen. Es geht in ihr darum, diese Öffnung gemeinsam zu tragen – als ein nicht begründetes Gemeinsames.
Ihrem Selbstverständnis nach unbegründet ist auch die Autonomie, die viele als das Hauptanliegen der westlichen Zivilisation beschreiben: ein Selbst, das sich selbst nur insofern bestimmt, dass es auf sich selbst reflexiv bezieht und deshalb aber zugleich sich selbst als ein anderes erfährt; sich zu einem anderen hin in sich selbst öffnet.
Nun zeugt die Geschichte des Westens von der Schwierigkeit des demokratischen Prozesses und den Widersprüchen des Autonomieanliegens, was sich heute zu einer multidimensionalen Krise verschärft hat. Die Schattenseite unserer Zivilisation ist spätestens seit dem 20. Jahrhundert deutlich sichtbar geworden.
So sehr das Abendland, wie es früher hieß, die Öffnung zum anderen in sich selbst anstrebte, hat es zugleich nicht aufgehört, den Anderen auszumerzen, auszulöschen, zu vernichten: in den Kolonien, in den Vernichtungslagern, in den Gulags, und, planetarisch erweitert, in der Naturzerstörung und der Zerstörung von Lebensraum – eine unaufhaltsame Geschichte der Beherrschung bis hin zum endlosen Konsum des Anderen in der technoökonomischen Produktion des Spätkapitalismus.
Trotz all des Guten, das das Streben nach Autonomie zeitigte, wie etwa die Forderung nach Gleichheit, hat dieses Streben zugleich nicht aufgehört, den Anderen und damit gleichzeitig sich selbst zu zerstören.
Die Philosophie versuchte und versucht weiter diese Entwicklung und damit auch sich selbst kritisch zu reflektieren, ohne den Anspruch auf ein unbegründetes Gemeinsames aufzugeben.
Philosophie mit den Mitteln des Begriffs, und Kunst mit den Mitteln des Sinnlichen, beide sind der Versuch, die Öffnung des Gemeinsamen je auf ihre Weise zu artikulieren, zu bejahen und zu teilen und damit zwischen uns offen zu halten.
Dieses Selbstverständnis ist allerdings ins Wanken geraten, und es stellen sich Fragen: Ist das Gemeinsame, wie es der Westen seit der Aufklärung dachte, die Selbstverwirklichung der Menschheit als Freiheit? Ist die Geschichte der Fortschritt dieser Selbstverwirklichung? Gibt es einen universalen Horizont für den Fortschritt?
Die Moderne und selbst die Postmoderne (trotz ihrer Kritik an der Moderne), sahen beide in dem Bruch mit der Tradition die Bedingung für die Emanzipation. Was die heutige Zeit von anderen unterscheidet, ist, dass dieses Schema grundsätzlich in Frage steht: Wir stecken zwischen Vergangenheit und Zukunft fest, ohne auf das Fortschrittsnarrativ der Moderne zugreifen zu können.
Kunst macht sichtbar
Nun hat sich die Kunst seit je her der Welt gegenüber verantwortet. Sie handelte mit den Mitteln, dem Sensorium, dem Material oder der Gefühlslage ihrer Zeit und öffnete dahingehend stets den Verhandlungsraum dessen, was ich anfangs als unbegründetes Gemeinsames bezeichnet habe. Damit meine ich nicht den in den Künsten jeweils dargestellten Inhalt, sondern das Moment, das ein Material als lebendige Entfaltung oder als lebendigen Prozess teilbar macht.
Dies verdeutlicht etwa das berühmte Zitat von Paul Klee. Er schreibt: „Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern macht sichtbar“[2].
Nicht bloß: „sie zeigt etwas, das vorher nicht sichtbar war“, sondern vielmehr „sie macht sichtbar“ – intransitiv: sie macht das Moment der Öffnung der Sicht – das heißt hier des Spürens, der Wahrnehmung – teilbar.
Ähnlich hat es bereits Immanuel Kant hinsichtlich des Schönen formuliert. Alle Kräfte des Erkennens sind an der Wahrnehmung des Schönen beteiligt, aber es kommt nicht auf Erkenntnisse an. Der Gegenstand der Wahrnehmung wird nicht auf bestimmte, einzelne Merkmale festgelegt. Ohne Reduktion auf dieses oder jenes Merkmal, wird der schöne Gegenstand in der Gegenwart seines Erscheinens wahrgenommen.
[1] Jean-Luc Nancy, Wahrheit der Demokratie, Wien 2009, S. 85.
[2]Paul Klee, Schriften, Rezensionen und Aufsätze. Hrsg. Christian Geelhaar, DuMont Buchverlag, Köln, 1976, S. 118.
Wir verweilen bei der Betrachtung des Schönen, weil es sich selbst stärkt: ein lebendiges Entspringen, nichts Bestimmtes, Identifiziertes, sondern ein prozessuales Erscheinen, eine Öffnung. Eine Entfaltung, die deshalb lebendig und nicht fix und geronnen ist, weil sie das Moment, woraus sie entspringt, teilt: wie etwa in dieser Zeichnung von Bruce Marden von 1992 die Linien, die anstatt für etwas zu stehen, einen Raum aufteilen.
Kant sieht diese Öffnung als Öffnung des Raums von Möglichkeiten des Erkennens und des Handelns; der Raum, der immer vorausgesetzt ist, wenn wir dieses oder jenes erkennen oder tun. Diesen in unserer Erkenntnis und Handlung vorausgesetzten Raum der Möglichkeiten öffnet uns die Kunst.[3]
In der ästhetischen Betrachtung sind wir, sagt Kant, frei von jeder Bestimmung, von jeder fixierten Identifizierung. Damit sind wir aber zugleich frei für die Bestimmbarkeit unserer selbst und der Welt. Das, was Kant eher im betrachtenden Subjekt verortet, in den Erkenntniskräften jedes Subjekts, was aber andere nach Kant im Realen verorten, ist, was ich „unbegründetes Gemeinsames“ nenne: es ist die Öffnung, die nach Paul Klee sichtbar bzw. hörbar, berührbar, erfahrbar macht.
Auf der anderen Seite des Fensters
Vor dem Zeitalter des Subjekts, war die Öffnung, die sichtbar macht, Gott. Von dieser Öffnung her, erschien die Welt als geordnet, eine gottgegebene Ordnung. Die Erfindung der Zentralperspektive in der Renaissance entdeckte die mathematischen Gesetze dieser Ordnung: Die perspektivischen Abstände, die das Sichtbare in der Welt zu einer dispositio organisierten, drückten in der Welt eine göttliche Ordnung aus.
[3] Kant spricht vom Schönen, was bei ihm vor allem das Naturschöne heißt. Ich übertrage es hier auf die Kunst. Vgl. Martin Seel, Ästhetik des Erscheinens, Suhrkamp 2003.
So akzentuiert zum Beispiel Albertis Modell des Bildes den Blick, der durch ein geöffnetes Fenster auf die Welt gelenkt wird. Dieses Modell verlangt eine Künstlerin, die von einem vorausgesetzten Punkt aus nach den Dingen Ausschau hält. Das Außen, hier als perspektivischer Standpunkt, hält die Distanz aufrecht, welche die Figuren überhaupt sichtbar macht.
Doch mich interessiert hier, was im Zeitalter des Subjekts geschieht, wenn Künstler*innen allmählich entdecken, dass nichts, was sie sehen, für die Dispositio prädestiniert ist, dass es also keine vorgegebenen Hierarchien gibt, keine vorgegebene Ordnung, sondern dass die Welt „sich bewegt, kriecht und zittert, sobald man sich ihr nähert“[4]. Man kann etwa in der Malerei diese Entwicklung Bild für Bild nachverfolgen.
[4] Jean-Christoph Bailly, Le Champ mimétique, Seuil 2005, S. 288 (ich übersetze).
Die Malerei etwa lässt einerseits die Vielfalt allegorischer und historischer Themen hinter sich und geht dabei allmählich zum Motiv über – also zu isolierten Fragmenten der Realität, die sich von der Allegorie gelöst haben, während formal zugleich eine Ablösung der Linie zugunsten der Farbe geschieht.
„Diese von Goya vorweggenommene Bewegung“ (ich verfolge hier Jean-Christophs Baillys Beschreibung), „verläuft sowohl über Constables Wolken als auch über die Leichenteile, die sich Géricault in sein Atelier bringen ließ. Und auch wenn diese Bewegung später hauptsächlich in der Beziehung zur Landschaft aufgeht, wird sie die Realität des Sichtbarwerdens erreichen wollen, wie sie etwa Manet in ihrem Schwindel festhalten wird.“[5]
Hatte ein Göttliches einst das Maß für das Sichtbare gegeben, kommt einmal der Moment, in dem die Künstler*innen gleichsam durch das Fenster der Perspektive hindurchschreiten und sich auf der anderen Seite des Fensters mitten im Realen befinden. Es ist, als würden sie selbst in die Landschaft treten, in die Welt der Dinge auf der anderen Seite des Fensters, in der nichts – nicht einmal ein Körper – in fester Gestalt erscheint.
Und wenn die Künstler*innen sich dieser Welt jenseits der Perspektive nähern, erkennen sie, dass diese etwas völlig anderes ist als ein bloßer Hintergrund für dargestellte Figuren. Sie erkennen, dass sich die Welt „nicht in Ordnungsfächern kompositorischer Details präsentiert, aus denen man lediglich auszuwählen und Hierarchien zu schaffen hätte, sondern als ein Abgrund.“[6] Der Abstand, der sichtbar macht, das Außen, migriert nun in die Dinge hinein, als unfixierbare Lücke.
Subjekt
Das Außen, das einmal als Distanz der richtigen Perspektive das Sichtbare bestimmte, migriert bereits in der frühen Neuzeit ins Porträt und formt dessen Zentrum. Ich habe in einem früheren Vortrag vom Porträt als einer Rückseite des Subjekts gesprochen, als Rückseite des Paradigmas der Neuzeit. Mit Rückseite meine ich, dass das seine Epoche prägende Kulturschema des Subjekts im Porträt anders zur Erfahrung kommt: im Porträt bleibt die Öffnung im Herzen des Subjekts, im Gegensatz zur politischen Geschichte des Westens, zum anderen hin offen.
[5] Bailly, ebd. (ich übersetze).
[6] Ebd.
Halten wir kurz inne und fragen grundsätzlich: Was ist überhaupt ein Porträt? Blicken wir aufs Bild, erkennen wir: Ein Porträt ist die Selbstheit von jemandem, der nicht da ist. Man könnte sagen: Das Porträt enthält den Tod des*r Porträtierten, oder es überdauert seinen Tod. Bereits die Porträts von Fayoum in der Antike, auf Mumien gemalt, waren Porträts von Toten.
Gelungen ist in diesem Sinne ein Porträt, wenn es nicht lediglich die Wiedergabe eines Models als eines Gegenstandes ist, sondern ein Selbst zeigt. Ein Selbst ist ein Selbstbezug – ein Ausdruck, eine Geste – eine dynamische, lebendige Bewegung – keine statische Gegebenheit. (Ich wiederhole: Nichts Geronnenes.) Es ist die Autonomie als Subjekt im Sinne Hegels – die Aufhebung der Dualität von Subjekt und Objekt. Ein Etwas, das sich auf sich selbst wie auf ein anderes bezieht. Ein Etwas, das durch diese relationale Bewegung zu sich kommt und so zu einem „Selbst“ wird. Diese lebendige Bewegung des Selbstbezugs kennzeichnet für Hegel die Struktur eines Kunstwerks. Somit wird das, was Kant als Öffnung der Erkenntniskräfte im betrachtenden Subjekt verortet, bei Hegel zur Wirklichkeit des Kunstwerks.
Das Porträt gibt also nicht das Selbst als ein Etwas wieder – etwa wie bei der Identifizierung eines Verdächtigen bei der Polizei, sondern der Einzigartigkeit einer Person gemäß zeigt es ein Sosein seiner Existenz an: einen Ausdruck, eine Geste, ein bestimmtes Moment des Selbst.
Das Porträt aber, und deswegen erwähne ich es hier überhaupt, kann deshalb ein Selbst und kein Etwas zeigen, weil es die Abwesenheit des Porträtierten in seinem Herzen offenlässt. Blanchot, Derrida, Bailly, Lacoue-Labarthe und Nancy haben diese Erfahrung des Porträts sehr gut analysiert, und eben die Unbegründbarkeit des Subjekts im Porträt als Öffnung aufgezeigt.
Das Selbst ist kein Etwas, das hinter den Augen in unserem Schädel sitzt, sondern der Elan des in-der-Welt-seins. Der Elan seiner eigenen Existenz entspringt aus der Lücke hinter seinem Blick und er entspringt als Relation zu den anderen – sowie sein Blick: sein eigenstes Selbst, sein Blick ist die Öffnung hin zu einem Außen – zu uns, den Betrachter*innen. Der Blick schaut nach außen und begegnet unserem Blick. Somit tritt das Selbst nicht als Gegebenes hervor, sondern als die Öffnung einer Beziehung zu den Betrachter*innen, eine Beziehung folglich, die zu sich selbst nicht zurückkehrt, die nicht schließt. Das Porträt ist das Stattfinden einer Begegnung mitten im Realen: ein „Mit“.[7]
Diese Sicht auf das Porträt, die sich von Hegel frei inspirieren lässt, ist mir wichtig, weil sie das unbegründete Gemeinsame nicht mehr wie Kant im betrachtenden Subjekt, sondern mitten in der Welt, als Existenz, als reales Stattfinden einer Relation beschreibt. Wir haben gesehen, dass Kant das unbegründete Gemeinsame als Öffnung des Möglichkeitsraums der Erkenntniskräfte darstellt und somit das Gemeinsame potentiell in jedem/ jeder Betrachter*in verortet. Mit Hegel, oder genauer gesagt, mit einer zeitgenössischen Lektüre Hegels, erkennen wir im Porträt das „unbegründete Gemeinsame“ nicht bloß als Öffnung eines Raums von Möglichkeiten innerhalb des Individuums, sondern als offene Begegnung, als offene Relation zu immer anderen Betrachter*innen – quasi als Intervention im Hier und Jetzt.
Die Kunstbetrachtung ist das Moment, in welchem wir uns der Öffnung dieser Ko-existenz aussetzen. In diesem Sinn steht mit der Kunst unsere gemeinsame Existenz auf dem Spiel: unsere Möglichkeit, eine Welt zu teilen.
Rückseite
In der Kunst bleibt die Öffnung zum anderen hin erhalten. Nicht so in der Geschichte des Subjekts. Bereits für Hegel ist das Subjekt ein Bezug auf einen Anderen in sich selbst, allerdings um den anderen aufzuheben und so zu sich zurückzukehren (die dialektische Bewegung). Das Streben nach Autonomie des Selbst – die Geschichte als Zentralperspektive der Selbstverwirklichung der Menschheit, hat sich nicht nur als Fortschritt, sondern auch als Hegemonie verwirklicht. „Gott ist tot“ hat in dieser Geschichte die Hybris der Moderne als ein unendliches Können in Gang gebracht: ich strebe die Aneignung des Anderen und somit die Überschreitung meiner Endlichkeit an.
In der Kunst kam dennoch entlang der politischen Geschichte etwas zum Vorschein, das ich hier als ihre Rückseite bezeichne. Hier in den Worten Heiner Müllers:
[7] Vgl. Jean-Luc Nancy, Das Andere Porträt, diaphanes 2013 und Porträt und Blick, Legueil 2007, Jean-Christoph Bailly, L‘Apostrophe Muette, Hazan 1998, Jacques Derrida, Aufzeichnungen eines Blinden: Das Selbstporträt und andere Ruinen, Fink 2007, Didi-Hubermann, Was wir sehen blickt uns an, Fink 1999, Marita Tatari, Kunstwerk als Handlung, Fink 2017, S. 37-41.
„Was mich an Goya interessiert hat“, schrieb Heiner Müller Ende der 80er Jahren, „war der breite Pinselstrich, der für mich irgend etwas zu tun hatte mit der Situation Goyas in Spanien, das besetzt wird von einer Revolutionsarmee, die etwas zu tun hat mit Aufklärung (…). Die Soldaten der Revolutionsarmee traten allerdings auf als Invasoren, Unterdrücker (…) Wo hört jetzt der Fortschritt auf, wo fängt die Reaktion an? (...) diese Schichtung statt einer Perspektive (…) hat etwas zu tun mit der damaligen Situation der DDR.“[8]
Unruhe des Sichtbaren
Schichtung, Schwung, Bewegung, Selbstdifferenz machten die zentrale Erfahrung der modernen Kunst aus. So zum Beispiel bei Giacometti, der sich ins Epizentrum des Erdbebens der Konturen des Sichtbaren begibt, vor die Figur selbst, vor das, was man so nennt: einen Apfel, ein Gesicht.[9]
[8] Heiner Müller, „Fünf Minuten Schwarzfilm“, Gesammelte Irrtümer 2, Verlag der Autoren 1990, S. 137-150, hier S. 143. Vgl. Marita Tatari, Kunstwerk als Handlung, S. 170-175.
[9]. Jean-Christoph Bailly, Le Champ mimétique, S. 289.
Die Distanz, aus welcher heraus die Figur betrachtet wird, oder aus welcher heraus sie erscheint, migriert in die Figuren hinein, die fortan wie im Treibsand zu versickern scheinen. „Gott ist tot“, Nietzsches berühmtes Wort, bedeutet in der Kunst, anders als in der politischen Geschichte, dass kein Unsichtbares mehr den Schalthebel besitzt, der die Entfernungen in einem Sichtbaren regulieren würde – es gibt kein vorgegebenes Validierungssystem. Das Sichtbare kommt nie zur Ruhe. Selbst wenn es still zu stehen scheint, bleibt ein Pulsieren, ein rhythmisches Zusammenziehen und Ausdehnen von Bewegungen, die in alle Richtungen drängen.
Das gilt übertragen auch für die zeitgenössische Kunst, die ihrem Selbstverständnis nach, keine Maßstäbe vermittelt: sie ist weder die Kunst des Heiligen, noch der Natur. Sie tradiert ihre Frage als Rätsel, wie Adorno das bezeichnete, das nun mitten ins Reale drängt.
Die Philosophie des 20. Jahrhunderts hat die Gewalt der westlichen Geschichte mit dem Willen des Subjekts zur Autonomie in Zusammenhang gebracht. Von der kritischen Theorie zum Poststrukturalismus – und wir denken uns hier Nietzsche, Heidegger, Arendt, Levinas und andere dazu – hat sich die Philosophie mit den Widersprüchen ihres eigenen Anliegens auseinandergesetzt.
Der Poststrukturalismus und die französische Dekonstruktion haben den Widerspruch im Herzen des Subjekts beschrieben und für das Unentscheidbare dieses Widerspruchs plädiert, wie auch vor ihnen die Frankfurter Schule für die Negativität statt für die versöhnte Aufhebung des Anderen im Selbst plädiert hatte.
Wir können nicht autonom werden, das Subjekt ist nie frei, die Geschichte wird nie die Selbstverwirklichung des Subjekts werden. Wir können uns aber von der Destruktion abhalten, wenn wir das Unfixierbare im Herzen des Subjekts – und das heißt des Gemeinsamen – als Unentscheidbares – oder als Befremdliches, Beunruhigendes zulassen.
Lacoue-Labarthe begleitet im Künstlerporträt, allgemein (1980) eine Serie von Foto-Porträts von Urs Lüthi: Just another story about leaving. Dieselbe Person erscheint in steter Veränderung: als junger Mann, androgyn, als alte Frau. Das Wiedererkennen eines Selbst immer als Anderen. Die Flüchtigkeit der Identität ist Ausdruck dieser Grundambivalenz, deren Tilgung die Gewalt unserer Zivilisation ausmacht.
Jean-Francois Lyotard, der Verfasser des Werks Die Postmoderne Bedingung (1979), hatte aus einer grundlegenden Kritik der Gewalt der westlichen Zivilisation heraus, in den achtziger Jahren für das Undarstellbare plädiert und sich so gegen die Figuration positioniert. Lacoue-Labarthe, wie viele nach ihm, kritisierte Lyotard dahingehend, dass dieser damit das Undarstellbare substanzialisiert, es zu einem Etwas und also etwas Angeeignetem macht. Und er hatte, gegen Lyotard und gegen den Begriff der Postmoderne, für die Darstellung plädiert, für das unentscheidbare Spiel mit der Figur in der Figur.
Die Queerness der Geschlechter, die Queerness der Spezies, im Grunde alles flüchtige Werden der Dinge ist Ausdruck dieser unfixierbaren Distanz, wie etwa auch die serielle Kunst, die das Werden der Dinge ausstellt, den Fluss der Zeit, und macht so transformative Prozesse teilbar.
Entgrenzung der Kunstgeschichte
Die unfixierbare Distanz wird zu einer buchstäblich handelnden Kraft, die im Körper des Realen interveniert. Das Selbst kann nun nicht das eines Kunstwerks sein, ohne zugleich das seiner Sozialität, seiner Konfrontationen, seines Ausgesetzseins gegenüber Anderen zu sein. Die Komposition ist nun weniger eine des Gemäldes: sie wird zu einer Komposition des Realen, wie etwa in vielen Arbeiten der documenta fifteen zu sehen, unter anderem bei Tanja Brugueira:
Wie einmal der Blick des Porträts dem Hier und Jetzt des Betrachtens galt, so intervenieren Aktionen und Handlungen mitten im Realen. Und das, worauf es ankommt, ist nicht das Aufheben des Anderen im Selbstbewusstsein, sondern die Existenz als Körper ‚dort draußen‘, als unsere faktische, politische, reale Koexistenz.
Schon seit den frühen Avantgarden verschwimmen die Trennlinien zwischen den verschiedenen Künsten und zwischen Kunst und Leben. Die unauffindbare Distanz geschieht zunehmend „transversal“, wie Guattari (und Deleuze) es nennen, durch die überlieferten Disziplinen und Erfahrungsbereiche hindurch intervenierend. Der Schwerpunkt wird auf Neuaufteilungen der sozialen Organisation versetzt.
Rancière hatte schon einmal die autonome Kunst als Neuaufteilung des Sinnlichen beschrieben.[10] Denn selbst das Sinnliche und unser Sensorium sind durch eine bestimmte soziale Organisation gefiltert. Die Arbeit der Kunst im Sinnlichen bringt das geformte Sensorium in die Schwebe und verstört die mit ihm einhergehenden sozialen Hierarchien, eröffnet somit einen Emanzipationsraum.
[10] Jacques Rancière, Die Aufteilung des Sinnlichen – Die Politik der Kunst und ihre Paradoxien, b-books 2006 und des., Das Unbehagen in der Ästhetik, Passagen 2016.
[Hier Mark Bradford‘s "Spoiled Foot“ ursprünglich für den US-Pavillon auf der Biennale di Venezia 2017 geschaffen und derzeit am Hamburger Bahnhof zu sehen: eine monumentale Skulptur, die wie ein riesiger Ball im Raum hängt, zwingt die Besucher*innen sich zu bücken und bringt so die Betrachter*innen mit der Erfahrung marginalisierter Gemeinschaften angesichts systemischer Gewalt und Unterdrückung in Kontakt].
Dekoloniale und intersektional-feministische Theorien entlarvten seit den 2000er Jahren die Verblendungen der Kulturgeschichte und damit auch der Kunstgeschichte, und sie stellten dabei den Kunstbegriff insgesamt in Frage. Kunstwerke ließen sich nicht mehr in einem fortschrittsgläubigen Schema verorten, und neue, aus der offiziellen Geschichte verdrängte Namen, Werke und Geschichtslinien wurden entdeckt.
Theoretiker*innen und Praktiker*innen reflektieren die Verflechtung der Kunstwerke mit kolonialen und kapitalistischen Strukturen, machen die rassistischen Verblendungen der Philosophie sichtbar und stehen für Praktiken ein, die die überlieferten Trennlinien zwischen Form und Materie unterbrechen, so zum Beispiel bei Denise Ferreira da Silvas und Arjuna Neumans Ancestral Clouds Ancestral Claims, Kunsthalle Wien 2023.
„Blackness“ und „Undercommons“ sind Begriffe aus der US-amerikanischen Theorie, die auf die Ausgeschlossenen im westlichen Universalitätsbegriff hinweisen, auf die Ausgeschlossenen auch im Kunstbegriff. Hier in den Worten Motens, Harneys und Halbersteams:
„Und so bleiben wir im Halt, in der Unterbrechung, als würden wir immer wieder in die zerbrochene Welt eintreten, um die visionäre Gemeinschaft [company] nachzuspüren und Teil von ihr zu werden.“[11]
Der Halt hier ist der Halt im Laderaum des Sklavenschiffs, aber es ist auch der Halt an Realität und Imagination. In der Zerbrochenheit, im „Undercommons“ zusammen zu sein, ist eine andere Weise, hier zu sein, diese Welt zu bewohnen.
Mit der Sichtbarwerdung der kolonialen Verbrechen des Abendlands einerseits und der zunehmenden Manifestierung der Klimakrise andererseits ist das Projekt der Subjektautonomie auch mit der Endlichkeit der Menschen konfrontiert: mit unserer Unmöglichkeit, völlig autonom zu sein. Die Vulnerabilität der Körper tritt in den Vordergrund.
Statt um das Erkenntnisvermögen, die Urteilskraft und das Selbstbewusstsein des Subjekts geht es hier um das Hervortreten der Interdependenz, der Körperlichkeit und der Relation als solcher, sowie mit Eduard Glissant auch um Prozesse der Kreolisierung zwischen Kulturen, Sprachen und Identitäten, die nicht linear und homogenisierend verlaufen.[12]
Mutation
Die Kunst antwortet also auf ihre Zeit, und selbst wenn sie dadurch diese Zeit durchbricht und fragmentiert, macht sie eine Rückseite ihrer kulturellen Gegenwart teilbar, ein „Undercommons“.
Wie ist aber unsere Gegenwart zu denken?
Während sich das Gefühl einer Ausweglosigkeit verbreitet, findet schleichend eine Transformation statt, deren Ausgang ungewiss ist.
[11] Fred Moten, Stefano Harney, The Undercommons – Fugitive Planing and Black Study, Einleitung von Jack Halberstam, Minor Compositions 2013, S. 4 (ich übersetze).
[12] Edouard Glissant, Philosophie der Weltbeziehung. Poesie der Weite, Das Wunderhorn 2021 und des. Kultur und Identität – Ansätze einer Poetik der Vielheit, Wunderhorn 2005.
Wie anfangs gesagt, glaubt die Moderne an die Selbstverwirklichung der Menschheit. Statt der Verwirklichung der Freiheit, ist daraus ein schrankenloser Produktionsvorgang entstanden. Neben der planetarischen Krise hat er auch eine Mutation des Subjekts hervorgebracht.
Die überlieferten Denkkategorien – Subjekt, Natur, Technik - verschieben sich. Wir sind heute nicht lediglich die Subjekte, die die Technik als Instrument einsetzen, um Produkte zu erzeugen. Vielmehr erweitert und verändert die Technik – als Prothese – unsere Subjektivität. Schon Stiegler zeigte im ausgehenden 20. Jahrhundert, dass Wahrnehmungen von der Mitwirkung exteriorisierter Gedächtnisträger abhängen, von Artefakten: vom Feuerstein bis zum Cloud Computing.[13] Heute sind wir eingebettet in Gefügen, die sich fließend verändern, uns durchqueren.[14]Simondon hat dabei die technologische Überschreitung der menschlichen Intentionalität Transindividuation genannt.[15]
Die aktuell stattfindende Transformation der Denkkategorien von Subjekt, Natur, Technik, ist eine tiefgehende kulturelle Transformation, ja sogar eine Mutation. Ich verwende das Wort „Mutation“ um anzudeuten, dass die Transformation bis in die Zellen reicht, in dem Bereich der Biologie und Natur, die eben heute zugleich Natur und Technik, Technonatur ist.
Die Technonatur wird nicht nur in der Gentechnik sichtbar, sondern etwa in der Klimakrise. Die Klimakrise verändert die planetarische Verfassung und destabilisiert unsere Lebenswelten. Sie findet nicht lediglich zwischen Menschen statt, sondern innerhalb einer umfassenderen planetarischen Techno-Natur.[16] An Stelle der Unterscheidung von Natur und Technik treten komplexe Wechselwirkungen zwischen Menschen und unterschiedlichen Arten von Nicht-Menschlichem: Gletschern, Unterwasserökosystemen, Bäumen, Winden, Industrieanlagen, Gewächshäusern, Nutztieren, Fahrzeugen, Kraftwerken, Autos.
Zugleich verändert die Klimakrise die tradierte Weise, Orte zu bewohnen und zu verstehen: Sie findet nicht an einem Ort statt, sondern vielmehr in Form von Verschiebungen und Übergängen von Menschen, Gütern, Energie, Informationen usw. Und sie entwickelt sich entlang einer nicht nur menschlichen Geschichte, sondern einer nichtmenschlichen "tiefen Zeit".
[13] Bernard Stiegler, Technik und Zeit: Der Fehler des Epimetheus, diaphanes 2009.
[14] Vgl. Marita Tatari und Erich Hörl, Die technologische Sinnverschiebung. Orte des Unermesslichen, in Tatari (Hrsg.), Orte des Unermesslichen, diaphanes 2014.
[15] Gilbert Simondon, Die Existenzweise technischer Objekte, diaphanes 2012.
[16] Vgl. Susanna Lindberg, From technological Humanity to Bio-technical Existence, SUNY 2023 und ders., “Planetary Thinking in the Era of Global Warning”, Inaugural Lecture, 20.11.2023, University of Leiden
Hier beispielhaft in einem Video von Adam (Sandra) Man, das in der techno-natürlichen Umgebung eines hochalpinen Wasserkraftwerks am Fuße eines schmelzenden Gletschers gedreht wurde.
Der Begriff der „Deep Time“, den John McPhee 1980 eingeführt hat und der in den letzten Jahren enorme Konjunktur erfährt, bezeichnet jene Zeitdimension, die das Fassungsvermögen des menschlichen Bewusstseins übersteigt. Ergänzt wird der Begriff durch die Mikrozeit, die Zeitdimension von elektronischen Schaltkreisen, die menschliche Wahrnehmung permanent unterlaufen. Die menschliche Kulturgeschichte ist mit Temporalitäten verzahnt, die sich ihr entziehen. Das Anthropozän, die durch die menschliche Tätigkeit bestimmte Epoche, konfrontiert uns mit dem Ende des Anthropozentrismus.
Die Philosophie versucht diese Transformationen von ihrer Rückseite her zu erfahren: die Klimakrise ist nicht nur eine Gefahr, sondern die Chance, anders zu denken. So reagieren manche zeitgenössischen Philosophien auf die Auflösung traditioneller Kategorien des Subjekts und auf die Auflösung der Dualität von Natur und Technik, indem sie das Denken des Subjekts durch ein Denken des Lebens ersetzen. Sie stellen den Fluss oder den Trieb des Lebens in seinem Zusammenhang mit dem Tod in den Vordergrund, – zum Beispiel als relationales Werden zwischen vielfältigen Milieus, Umwelten und sich fließend verändernden Ökosystemen. Diese Theorierichtung umfasst ein breites Spektrum unterschiedlichster Akzentuierungen und Strömungen, die von Bergson zu Henry, von Whitehead und Canguillehm zu Worms, und von Nancy und Malabou zu Lindberg reichen.
Wechselwirkungen und Ko-Abhängigkeit stehen auch im Mittelpunkt ökokritischer, neumaterialistischer und posthumanistischer Ansätze, die sich für eine Enthierarchisierung des Nicht-menschlichen unter dem Menschlichen einsetzen. Eine ähnliche Suchrichtung lässt sich auch in den Künsten finden.
[So etwa bei Dan Lie, eine der Preisträger*innen der Nationalgalerie Hamburger Bahnhof 2024, die natürlichen Kreisläufe der Transformation und gegenseitigen Abhängigkeit ausstellt, wobei nicht-menschliche Wesen – wie Bakterien, Pilze, Pflanzen und Mineralien – die Hauptakteure sind. Sie befasst sich mit dem Zusammenleben verschiedener Wesen und deren kontinuierlicher Beteiligung an den Prozessen von Leben, Tod und Verfall.]
Und dennoch stellen sich heute unsere mehr-als-menschlichen Beziehungsgeflechte in den Dienst der aus dem Anthropozentrismus der Moderne entsprungenen technoökonomischen Zwecksetzung.
Es reicht nicht, ein Denken des Subjekts durch ein Denken des Lebens zu ersetzen.
Unter Bedingungen technoökonomischer Hegemonie erfindet die Technologie endlos Zwecke, quasi entkoppelt aus dem Projekt der Selbstverwirklichung der Menschheit. Sie macht fortwährend ihre Mittel zu Zwecken. Die unendliche Freisetzung der Möglichkeit, Zwecke zu setzen, geht mit der Messbarkeit von allem nach ihrer Relevanz für immer neu erfundene Zwecke einher. Das allgemeine Äquivalent – Marx’ Ausdruck für das Geld – beraubt die Würde, das heißt die Singularität der Dinge. Alles kann als Mittel zum Zweck verwendet werden.[17]
Damit aber wird alles zerstört, was einmal als Endzweck, das heißt als an und für sich Wertvolles galt: die Natur, das Wozu, wozu das Leben, wozu der Reichtum – das Gemeinsame, wie ich das anfangs beschrieben habe. Die Klimakrise exemplifiziert das.
Deshalb scheint es mir heute entscheidend, weniger neue, angeblich enthierarchisierte Lebensbeschreibungen zu entwerfen, sondern sich vielmehr der Frage zu widmen, wie unter Bedingungen einer Technonatur ein unbegründetes Gemeinsames, das heißt – ich muss es an dieser Stelle betonen – ein an und für sich Wertvolles, zu denken, zu empfangen, zu erkennen und offenzuhalten ist.
Kann die Kunst die zeitgenössische Krise anders, sozusagen von deren Rückseite her erfahren und in ihr ein an und für sich Wertvolles empfangen und teilbar machen?
Plastizität des Lebens
Ich frage: kann heute die Kunst, zum Beispiel in den Verschiebungen, die die Klimakrise zum Vorschein bringt, eine Rückseite der Gegenwart finden, ähnlich wie das Porträt die Rückseite des Subjekts öffnete?
Wenn die Zwecksetzung heute zum Zweck wird, kommt zugleich die Bewegung der Zwecksetzung selbst zum Vorschein, die Bewegung, die über das jeweils gegebene hinaus und hin zu einem anderen geht. Herkunft und Endzweck lösen sich auf, und es bleibt der bloße Durchgang. Ohne Herkunft und Endzweck entsteht aber die Welt an jeder Stelle von neuem. Sie geht nicht von einer menschlichen Intentionalität aus, sondern von Verschiebungen innerhalb der Koexistenz, von Einschnitten in der Immersion, die jeweils punktuell und jeweils anders Koexistenz spürbar machen. Dies bezeichnen eine Reihe ganz unterschiedlicher Theroretiker*innen von Peter Osborne bis Donna Harraway als „Worlding“, ein Begriff, der ursprünglich von der Phänomenologie und von Heidegger herrührt (die Welt „weltet“).[18]
„Worlding“ interveniert durch das Geflecht unserer gesellschaftlichen, technologischen, natürlichen, materiellen Koexistenz hindurch, und agiert quer über die tradierten Kategorien hinweg: ein „Worlding“, das mit einem „Unworlding“ und einem „Reworlding“ einhergeht.
Im Zentrum der Begriffe „Ökotechnik“,[19] „Cosmotechnics“[20], und Lebens-Technik, so wie sie u.a. Susanna Lindberg, Yuk Hui und andere verwenden, liegt die Distanz, die die Einheit des technologischen Prozesses punktuell aufbricht und diverse Ko-artikulationen zwischen Lebensformen und Beziehungsgeflechten ermöglicht und ausstellt. Denn es ist diese Distanz – um es hier noch einmal zu betonen – die Empfindung, Erfindung, Erkennen und Teilung ermöglicht.
Keine Relation ohne Distanz. Kein Sichtbares ohne Unterscheidung. Kein Berührbares, kein Erfahrbares ohne Öffnung. Weniger die Öffnung der Erkenntniskräfte des Subjekts, wie bei Kant, und mehr die Distanz, die unsere Fragilität mit Sorge trägt und Raum für ein plurales Mit-Werden öffnet.
[17] Marita Tatari, „Die Technik ist die Transzendenz – Gerechte Poetik“, in L. Viglialoro und D. Gentili (Hrsg.), Techniken des Gemeinsinns: Politik - Ästhetik - Technik, Velbrück Wissenschaft 2024, S. 13-26.
[18]Vgl. Dona Haraway, Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene, Duke University Press 2016, A. Magun, S. Lindberg, M. Tatari (Hrsg.) Thinking With – Jean-Luc Nancy, diaphanes / The University of Chicago Press 2021, Peter Osborne, The Postconceptual Condition, Verso 2018.
[19] Susanna Lindberg, From Technological Humanity To Bio-Technical Existence, a.a. O.
[20] Yuk Hui, Pieter Lemmens (Hrsg.), Cosmotechnics: For a renewed concept of technology in the Anthropocene, Routledge 2021.
Ist es möglich, die Einbildungskraft nicht des Subjekts, sondern der werdenden Materie, die wir mit-sind, zu denken?
Das ist ein Forschungsfeld, das mich gerade besonders interessiert, und das ich zwischen Kunst und Philosophie und zwischen Tradition und Gegenwart erkunden möchte.
Wenn sich Plato auf eine Aufnahmestätte aller Formen und Dinge bezog, benutzte er den Begriff der Khora, die er als eine Empfängerin und gleichzeitig Amme des Werdens bezeichnete. Ein Zwischenraum, der den Raum des Möglichen öffnet.
Können wir diesen Zwischenraum der werdenden Materie denken? Oder, mit Catherine Malabou formuliert, die Plastizität des Lebens?[21] Die Plastizität als die Fähigkeit zur Transformation, die wir mit-sind, wenn wir eine Öffnung zwischen Menschen, Tieren, Abfall, Verfall, Regeneration, Ökosystemen, Pflanzen, Felsen als ein an und für sich Wertvolles aufrechterhalten? Und zwar jeweils punktuell, im Hier und Jetzt unseres Denkens und unseres Tuns. Bis hin zu dem ambivalenten Punkt zwischen Destruktion und Regeneration, an dem beide als Möglichkeiten offenstehen.
Die Lücke zwischen Vergangenheit und Zukunft
„Die Lücke zwischen Vergangenheit und Zukunft“ ist der Titel eines Essays von Hannah Arendt.[22] Zwischen Vergangenheit und Zukunft befindet sich für sie der Ort des Denkens. An dem Ort, an dem wir stehen, hier und jetzt, entsteht, wenn wir denken, die Lücke der Zeit, das heißt, ein Außerhalb, das den Zeitfluss unterbricht. Erst aus dieser Lücke heraus teilt sich die Zeit in Vergangenheit und Zukunft.
Der Ort des Denkens ist so gesehen, das Entspringen der Zeit und nicht die Zeit selbst als stete Abfolge von Gegenwarten. Der Ort des Denkens ist die Lücke im Hier und Jetzt, die in der Gegenwart das Ankommen der Zukunft offenhält.
Solange eine Tradition den Stand und den Fluss der Dinge vorbestimmte, schreibt Hannah Arendt, war dieser Ort des Denkens, ich zitiere, „den wenigen vorenthalten, die das Denken zu ihrem Hauptgeschäft machten“[23].
Es war der Ort des Geistes als Theoria. Nach dem Bruch mit der Tradition, schreibt Arendt, wurde dieser Ort, der in der Gegenwart die Zukunft öffnet, nicht mehr den Wenigen vorenthalten. Er wird zur greifbaren Wirklichkeit für alle und ist daher von politischer Bedeutung. Jede neue Generation hat diesen Ort neu zu finden.
Was Hannah Arendt vor etwa siebzig Jahren für ihre politische Gegenwart schrieb, gilt heute vervielfacht. Wir können nicht allein auf die Tradition und auf ein geerbtes Selbstverständnis bauen. Und dennoch stecken wir in den vertrauten Denkschemata fest, wie in einer ausgedehnten Gegenwart, die sich zwischen Vergangenheit und Zukunft verfangen hat. Wir versuchen die Zukunft zu fassen, zu beherrschen, zu managen.
Deshalb betone ich nochmals, wie wichtig es für uns als Lehrende, als Studierende, als Denkende und als Schaffende ist, unsere Grenzen, unser Unwissen und die Unsicherheit des Ausgangs der Situation, anzuerkennen.
Nur dann wird unser Denken, ganz im Sinne Arendts, zu einem „Denken ohne Geländer“. Weniger eine Sache der Theorie, die Richtlinien für die Zukunft geben würde, und vielmehr eine der Praxis. Es ist eine Haltung ohne vorgefertigte Antworten, die für das Gemeinsame mitten in der Welt einsteht, sich für die Welt verantwortet und neue Zugänge zur Geschichte sucht, sowie zu dem Gegenwärtigen, das vor uns ist.
Wie bei Perlentaucher*innen, die in der Meerestiefe Bruchstücke aus Schiffswracks an die Oberfläche holen, geht es heute darum, aus der Vergangenheit das heraus zu fischen, was uns in gleichem Maße zuspricht – Bruchstücke aus der Vergangenheit nach ihrer Verwitterung durch die See, wie es etwa Arendt mit Shakespeare beschreibt.[24] Dass wir mit diesen Bruchstücken etwas anfangen können, das verdanken wir der Lücke, dem zeitlosen Pfad, schreibt Arendt, den das Denken in die Welt von Raum und Zeit schlägt.
Es geht gleichermaßen darum, in dem, was in unserer Gegenwart steckt, was also direkt vor uns schon da ist, ein an und für sich Wertvolles zu entdecken.
Um diese aus meiner Sicht zentrale Haltung zum Schluss auf eine Aktivität der Kunsthochschule zu beziehen:
Im Gespräch mit den Studierenden der Kunstwissenschaft Anastasia Patapkina und Pavel Khisznyak, und im Rahmen der von ihnen kuratierten Ausstellung (Dis)ordering Things in der Gallerie oqbo in Berlin im November, sagte die Künstlerin Nanne Meyer sinngemäß: Ich habe keine Ordnung im Kopf. Ich gehe von dem aus, was schon da ist, was mir begegnet, und irgendwann plötzlich etwas springt. Es beginnt in der Unbestimmtheit, ein Wagnis, und durch das Tun entsteht etwas, das stimmt; eine Form, die ich mir vorher nicht ausdenken konnte und die mich überrascht.
Ich meine, dass die Lücke der Zeit auch als dieses Sprungbrett zu verstehen ist, von dem aus man ins Ungewisse aufbricht.
Lassen Sie uns zuletzt solche Sprungbretter als Einschnitte in unsere Koexistenz verstehen, aus welchen heraus sich eine gemeinsame Zukunft öffnet.
In diesem Sinne danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit!
[21] Catherine Malabou, Plasticity – The Promise of Explosion, Hrsg. von Tyler Williams, Edinburgh University Press 2022.
[22] Hannah Arendt, „Die Lücke zwischen Vergangenheit und Zukunft“, Zwischen Vergangenheit und Zukunft, Piper 2012, S. 7-20. Vgl. auch Hannah Arendt, „Die Lücke zwischen Vergangenheit und Zukunft: das nunc stans“, Vom Leben des Geistes, Piper 1998, S. 198-208.
[23] Arendt 2012, S. 17.
[24] Arendt 1998, S. 208.