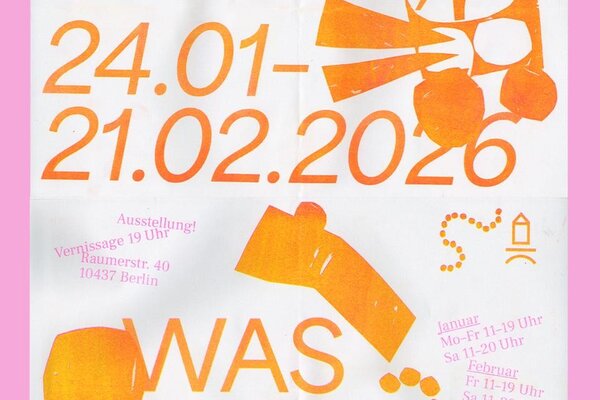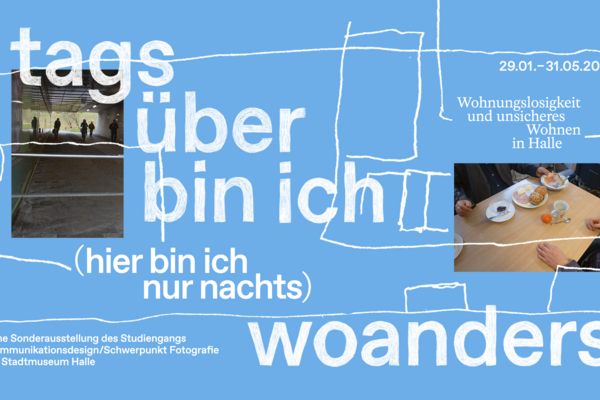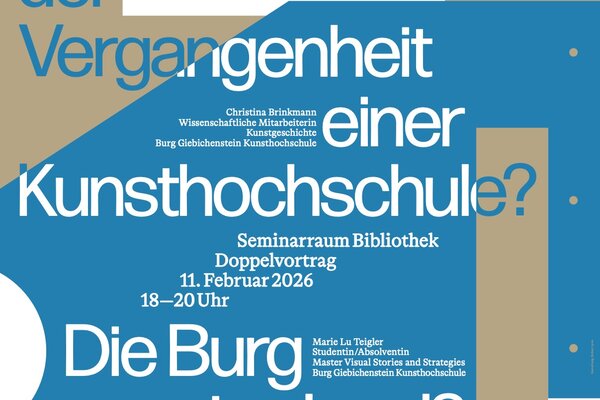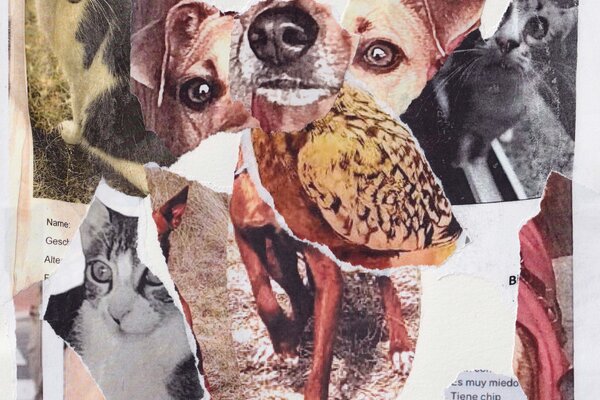Der Stadt Zeitz im südlichen Sachsen-Anhalt ist der Rückgang der Industrialisierung deutlich anzusehen. Zwischen Leerstand und Zerfall probieren kreative und partizipative Projekte Fuß zu fassen. Mit Sanierungen, Ausstellungen und Veranstaltungen sollen Industriebrachen und ihre Geschichte wiederbelebt werden, wie die ehemalige Kinderwagenfabrik ZEKIWA oder die Brikettfabrik Hermannschacht. Das Schloss Moritzburg repräsentiert hingegen Hochkultur.
Mithilfe von Texten aus den Feldern Architektur- und Raumtheorie werden qualitative Methoden zur Analyse des Stadtraums vermittelt. Vor Ort werden Grundlagen der Architekturanalyse geübt. Im Anschluss erschließen die Teilnehmenden aus verschiedenen Perspektiven, welche Aspekte die gewachsene und teils verfallende Stadt prägen und testen methodische Herangehensweisen. Auf theoretischer Ebene steht der Begriff der Moderne im Fokus: Wo findet sich in Zeitz die Moderne? Kommt sie noch, ist sie bereits vorbei oder war sie nie dort gewesen? Beobachtungen aus Spaziergängen in der Stadt werden in collageartigen Formaten gesammelt und analysiert.
Die Kompaktwoche startet mit der Vermittlung von grundlegenden Methoden zur Beschreibung und einführenden theoretischen Texten (Lynch und Rowe), die Fragen nach der Vorstellung von Moderne und Zukunft aufwerfen. Start: 8.12., 9 h, Seminarraum Bibliothek, Neuwerk 7, Campus Design, Halle. Von Mittwoch bis Freitag (10.12. bis 12.12.) begeben wir uns auf eine kurze Exkursion nach Zeitz, inklusive zweier Übernachtungen. Für die erfolgreiche Seminarteilnahme müssen diese beiden Tage von jeglichen anderen Terminen freigehalten werden. Übernachtungskosten werden übernommen. Am Freitag sammeln wir die Ergebnisse und führen diese zu einer Mini-Ausstellung zusammen.
Das Seminar ist eine Kooperation der Design- und Architekturgeschichte, Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle und der Anthropogeographie, Martin-Luther Uni Halle-Wittenberg.
Die einführende Literatur wird im Seminarapparat in der Burg-Bibliothek sowie digital zur Verfügung gestellt.
Einführende Literatur:
- Ash Amin & Nigel Thrift (2002): Cities. Reimagining the Urban. Cambridge: Polity.
- Lucius Burkhardt (2013): Der kleinstmögliche Eingriff. Berlin: Martin Schmitz.
- Isa Genzken, Beatrix Ruf (2006): I love New York. Crazy City, Zürich: Ringler Kunstverlag.
- Susanne Hauser, Christa Kamleithner, Roland Meyer (Hg.) (2011): Architekturwissen. Grundlagentexte aus den Kulturwissenschaften, Bd. 1, Zur Ästhetik des sozialen Raumes. Bielefeld: Transcript.
- Kevin Lynch (1965): Das Bild der Stadt. Berlin, Frankfurt/M., Wien: Ullstein.
- Colin Rowe, Fred Koetter (1997). Collage. City. Basel: Birkhäuser.
Lern- und Qualifikationsziele BA und MA: Um die Lern- und Qualifikationsziele zu erreichen, werden in Einzel- oder Gruppenarbeit zu erarbeitende Präsentationen der Seminarinhalte erwartet. Die Formate differieren und können von Plakatgestaltungen über Vitrinenausstellungen bis zu schriftlich fixierten Konzeptpapieren reichen. Die Abgabe erfolgt zum Ende der Kompaktwoche.
Lern- und Qualifikationsziele MA Design Studies: Um die Lern- und Qualifikationsziele zu erreichen, werden zusätzlich zur Präsentation der Seminarinhalte in individuell wählbaren Formaten jeweils eine schriftliche Hausarbeit im Umfang von 20 Seiten oder eine vergleichbare vertiefende Leistung erwartet.