Das Forschungsprojekt Symbiotic Subjects untersuchte, wie Menschen und Mikroorganismen symbiotische Beziehungen eingehen können, um Materialien, Prozesse und Dienstleistungen ko‑kreativ zu gestalten und damit Design neu zu denken.
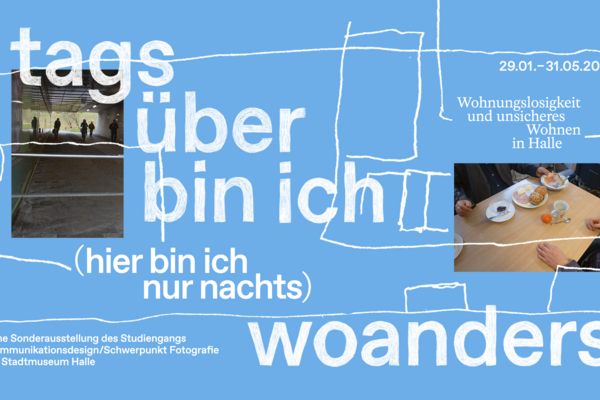
Das Forschungsprojekt Symbiotic Subjects untersuchte, wie Menschen und Mikroorganismen symbiotische Beziehungen eingehen können, um Materialien, Prozesse und Dienstleistungen ko‑kreativ zu gestalten und damit Design neu zu denken.
Mikroorganismen sind meist unsichtbar, doch ihr Potenzial für das Design nachhaltigerer Produkte und Kreisläufe ist enorm: Sie wachsen, wandeln Stoffe um und bilden komplexe Netzwerke. Unter dem Dachthema Symbiotic Subjects – Beneficiary Relations and Interactions erforschte das BioLab, wie sich diese Fähigkeiten in gestaltungsorientierten Kooperationen (Co-Creations) nutzen lassen. Statt die Natur ausschließlich als Ressource zu betrachten, untersuchte das Projekt neue Partnerschaften, in denen Mensch und Organismus wechselseitig voneinander profitieren.
Viele biologische Prozesse entziehen sich einer menschlichen Kontrolle. Anstatt dies als Nachteil oder Hindernis zu betrachten, sollte in diesem Projekt die Interaktion mit den Organismen in Gestaltungsprozessen diskutiert und explorativ erforscht werden. Konkret stellten sich die Fragen:
Wie lässt sich mikrobielles Wachstum zur Gestaltung planen, durchführen und untersuchen? Welche Gestaltungsprozesse sind möglich, ohne dass diese einen negativen Effekt auf die mikrobielle Vitalität haben bzw. wann profitieren die Organismen von der Interaktion? Wie können Gestalter*innen und Mikroorganismen gemeinsam gestalterisch tätig werden?
Das Projekt wurde in zwei Teilen konkretisiert: Bio.Lumina erforschte, wie sich formgebende Verfahren so adaptieren lassen, dass die damit hergestellten Lebensräume die Aktivität und Lebensfähigkeit von Mikroorganismen unterstützen. Um die Einflussparameter der gestalteten Lebensräume einschätzen zu können, wurden Bakterien verwendet, die sich durch Biolumineszenz auszeichnen, einem biochemischen Prozess, bei dem Energie in Form von sichtbarem Licht abgegeben wird und der nur von lebenden Zellen durchgeführt wird. Das Teilprojekt Living Layers knüpfte daran an und griff die in Bio.Lumina sichtbar gewordenen Herausforderungen wie Nährstoffversorgung, Gastransfer und Schutz vor Kontamination auf. Inspiriert von natürlichen Schichtsystemen und Membranen untersuchten wir, wie sich diese Prinzipien gezielt in der Gestaltung einsetzen lassen, um die Mikroorganismen langfristig zu stabilisieren und ihre Lebensfähigkeit zu fördern.
Wir verstehen Symbiotic Subjects darüber hinaus als Impuls, zu einem alternativen Design-Paradigma beizutragen, das Wachstum als interaktiven und gestaltbaren Prozess begreift und zugleich die Autonomie des Lebendigen respektiert: Um die vorteilhaften Wachstums- und Materialeigenschaften von Mikroorganismen nutzen zu können, müssen Gestalter*innen die Technologien zur Verarbeitung der Mikroorganismen an deren biologische Bedürfnisse anpassen – nicht umgekehrt. In den experimentellen Arbeiten der Teilprojekte wurden Formgebung, Prozessparameter und Geometrie jeweils so ausgelegt, dass Nährstoffzufuhr, Gasaustausch und Feuchtespeicherung den Bedürfnissen der Organismen und des Nutzungszyklus angepasst sind. Nur in einer solchen prozessspezifisch entworfenen Umgebung blieben die Organismen vital und nutzbar für die Formgebung und Gestaltung. Einen solchen künstlichen Lebensraum zielgerichtet zu gestalten, stellte sich als eine zentrale Herausforderung im Forschungsprozess heraus – insbesondere im Ausblick auf Produkte, die sich regenerieren, an Umweltreize anpassen und in geschlossene Stoffkreisläufe eingebettet sind.
Als Inspiration für das Teilprojekt Bio.Lumina diente die natürliche Symbiose zwischen dem hawaiianischen Bobtail-Tintenfisch Euprymna scolopes und dem biolumineszenten Bakterium Aliivibrio fischeri. Diese Symbiose ermöglicht dem Tintenfisch eine effektive Tarnung bei Mondschein durch biolumineszentes Leuchten, das bereits innerhalb von 48 Stunden nach der Geburt vollständig ausgebildet ist. Dazu entwickelt der Tintenfisch ein spezielles Leuchtorgan, in dem die Bakterien angesiedelt, genährt und gezielt zum Leuchten gebracht werden. Der Tintenfisch schafft in dem Leuchtorgan ideale Lebens- und Wachstumsbedingungen für die Bakterien.
Ziel des Projekts war es, die biochemischen und strukturellen Voraussetzungen zu erforschen, die Materialien erfüllen müssen, um ähnlich gute Lebensräume für die biolumineszierenden Bakterien zu schaffen und so ihre mikrobielle Aktivität langfristig sicherzustellen. Angelehnt an die experimentellen Arbeiten sollte darüber hinaus diskutiert werden, wie Designer*innen zukünftig mit lebenden Organismen gestalten können.
Um eine dem natürlichen Leuchtorgan möglichst ähnliche Umgebung für die Bakterien zu schaffen, stellten wir Hydrogele aus dem algenbasierten Biopolymer Alginat her. Dieses erschien dafür besonders geeignet, da es sowohl günstige Bedingungen in Bezug auf Wasserspeicherkapazität, Nährstoffversorgung, pH-Wert und Schutz bietet als auch in vielfältige Formen und Geometrien überführbar ist, was gestalterisch relevant ist. Zunächst stellten wir Kügelchen, Folien sowie Pasten her und beimpften sie mit den Bakterien. Im zeitlichen Verlauf der Kultivierung wurden danach systematisch Parameter wie Wasserverlust, pH-Wert-Veränderungen, Kontaminationen und Biolumineszenz mit dem Ziel untersucht, eine anhaltende, sichtbare Leuchtkraft der Bakterien sicherzustellen – was Aufschluss über die Lebendigkeit’ der Bakterien gab.
Die Untersuchungen zeigten deutlich, dass eingebettete Mikroorganismen für einige Zeit metabolisch aktiv bleiben, wobei hauptsächlich der Feuchtigkeitsverlust für das spätere Nachlassen der Lumineszenz verantwortlich ist. Entscheidend waren außerdem die Sauerstoffdiffusion, Porosität und die Verfügbarkeit von Nährstoffen im Material. Diese beeinflussten die Vitalität und Leuchtkraft der Organismen stärker als die Wahl des Materials oder die Verarbeitungsweise. Um eine ausreichende Nährstoffverfügbarkeit sicherzustellen, waren gezielte Eingriffe vonnöten. Dementsprechend sollte die Versorgung der Organismen in die Konzeption zukünftiger Produkte integriert werden, was z. B. durch angepasste Nutzungsdauer oder durch eine auf die Bedürfnisse der Organismen abgestimmte Produktwartung geschehen kann. Diese Erkenntnisse bildeten die Basis für die Arbeit am Folgeprojekt Living Layers, in dem untersucht wurde, wie weit eine adaptierbare Nährstoffversorgung durch modulare Schichtsysteme möglich ist.
Living Layers untersuchte den Aufbau mehrschichtiger Strukturen für eine adaptierbare Nährstoffversorgung von Lebensräumen für Bakterien und andere Mikroorganismen. Als Inspiration diente das Modell der Haut – mit ihrer atmungsaktiven, schützenden Außenschicht und den darunter liegenden, hoch spezialisierten Zonen. In diesem Modell sind Schutz, Versorgung und Funktionalität nicht getrennt, sondern in einer durchlässigen Grenzfläche miteinander verwoben. Das Projekt näherte sich dem Thema anhand zweier industrieller Fertigungsverfahren. Um feine, biokompatible Membranen zu erzeugen, die Luft und Feuchtigkeit passieren lassen und zugleich wie ein Filter wirken können, wurde das Verfahren des Electrospinning eingesetzt. Hierbei erzeugt ein sehr starkes elektrisches Feld Nanofasern, die in hauchdünnen Schichten aufgetragen werden können. Obwohl sich sogar Organismen direkt einarbeiten und damit hybride Materialsysteme erzeugen ließen, erwiesen sich die Ergebnisse als nicht reproduzierbar genug. Für eine einfachere, flexiblere Herstellung von Schichten kam deshalb das Verfahren des Dip Moulding zum Einsatz. Damit konnten Alginatfolien unterschiedlicher Dicke hergestellt werden, was die Steuerung von Stabilität und Gasdurchlässigkeit gleichermaßen zuließ. Um den Nährstofftransport zwischen den Alginatschichten nachzuweisen, wurden in eine erste Schicht immobilisierte Nährstoff-Beads eingebettet und darüber eine zweite Alginatfolie mit Algenkulturen platziert. Die Algen wuchsen ausschließlich dort, wo Nährstoffe durch Diffusion verfügbar waren – ein direkter Beleg für den Stoffaustausch über die Grenzschichten hinweg.
In einer Erweiterung des Verfahrens wurden gegossene Alginatgele im tiefgefrorenen Zustand gehärtet. Interessanterweise entstanden dabei dünnere, definierte Schichten mit verbesserter Durchlässigkeit. Dieses als Freeze Moulding bezeichnete Prinzip nutzen wir in dem folgenden Projekt Habitat zur Herstellung komplexer, dreidimensionaler Objekte.
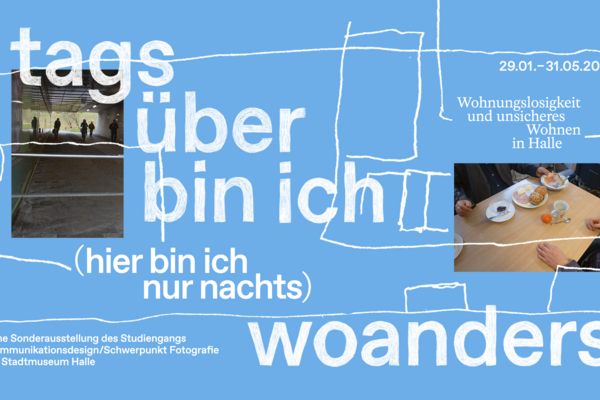


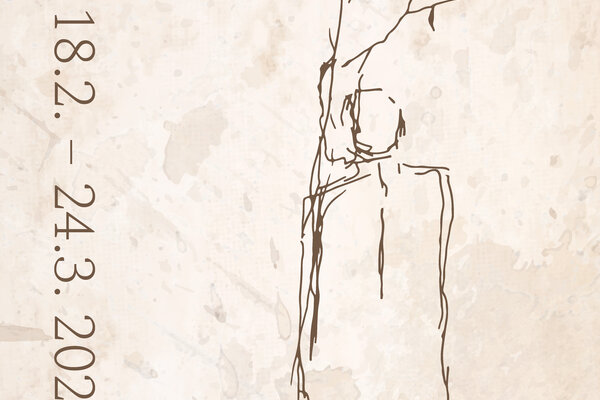
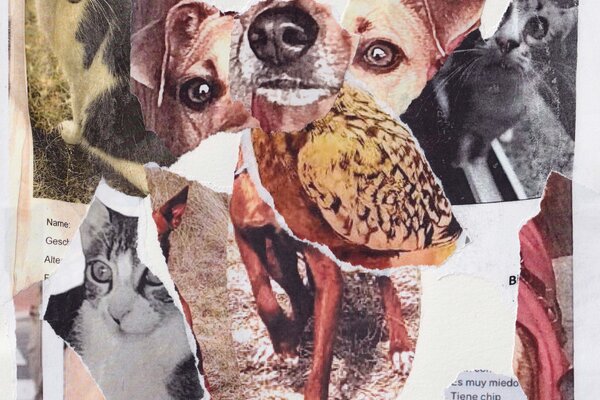
2020-2021
Johann Bauerfeind
Dr. Falko Matthes
Fabian Hütter
Andi Wagner
Dr. Maja Rischer
Prof. Mareike Gast
Prof. Pablo Abend
Residency Bio.Lumina
Residency Living Layers